In einem akuten Anflug von kompletter Arbeitsunlust über die Weihnachtsfeiertage habe ich innerhalb von knapp einer Woche die vierteilige „Twilight“-Vampir-Saga aus der Feder von Stephenie Meyer durchgeackert (deutscher Titel: „Bis(s) zum Morgengrauen“).
Ja, ich weiß, jetzt stöhnen einige Blog-Leser da draußen auf … „jetzt liest der endlich mal ein Buch und dann so einen Teenage-Schund?“ :-). Es ist in der Tat schon einige Zeit her, seit ich über 2000 Seiten in so kurzer Zeit von einem einzigen Autor vertilgt hätte, aber ich musste einfach mal wieder „abschalten“ und da kam mir diese unkomplizierte Teen-Vampir-Soap gelegen. Der Hype um „Twilight“ ist zugegebenermaßen in den letzten Jahren komplett an mir vorübergegangen, lediglich die Meldungen um den Kino-Start der Verfilmung des ersten Bandes habe ich nebenbei registriert. Seit ich mir dann die vier Bände in der Originalfassung bei einer Freundin für ein paar Tage „unter den Nagel reißen“ konnte, habe ich aber meine „Popkultur“-Wissenslücke wieder gefüllt und verstehe nun endlich auch die endlosen „Bella & Edward„-Referenzen im Web ;-). Man muss ja auf dem Laufenden bleiben und als schrilles Big-Budget-Kontrast-Programm zu „Let the right one in“ ist die Sache eine Betrachtung wert.
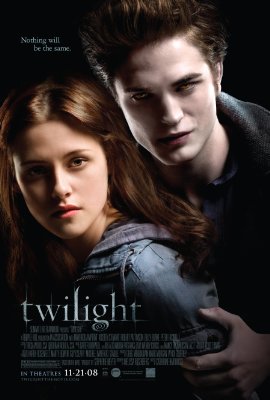 Die „Twilight“-Saga fällt eigentlich in den Bereich der „Young Adult“-Literatur und richtet sich auch wohl vor allem an die weibliche Leserschaft — also schon gleich zwei wesentliche Zielgruppen-Kriterien, die ich nicht erfülle — was mir aber wie eingangs erwähnt recht egal war. „Twilight“ erzählt im Wesentlichen die Liebesgeschichte zwischen der 17jährigen Schülerin Bella Swan und dem zumindest äußerlich gleichaltrigen Vampir Edward Cullen. Bella ist nach der Scheidung ihrer Eltern aus dem sonnigen Phoenix zu ihrem Vater in das verregnete Forks in der Nähe von Seattle gezogen, um ihren High-School-Abschluss zu machen. Dort ist sie erstmal „die Neue“, aber rasch weckt eine mysteriöse Familie ihre Aufmerksamkeit, die am Rande des kleinen Städtchens lebt. Insbesondere einer der „Söhne“, Edward Cullen, fasziniert sie auf ganz seltsame Weise und bereits nach kurzer Zeit verbindet die beiden eine besondere Beziehung. Es entwickelt sich eine ungewöhnliche Liebesbeziehung zwischen einer schüchternen und tollpatschigen Schülerin mit angeschlagenem Selbstbewusstsein sowie einem attraktiven und mysteriösen, jungen und unsterblichen Vampir, die fortan Stoff für vier Romane liefert. Gemeinsam müssen sich die beiden durch zahlreiche dramatische Situationen kämpfen, die nicht nur ihre ungewöhnliche Beziehung oftmals stark strapaziert, sondern auch ihre Freunde und Familien diverse Male in Lebensgefahr bringt.
Die „Twilight“-Saga fällt eigentlich in den Bereich der „Young Adult“-Literatur und richtet sich auch wohl vor allem an die weibliche Leserschaft — also schon gleich zwei wesentliche Zielgruppen-Kriterien, die ich nicht erfülle — was mir aber wie eingangs erwähnt recht egal war. „Twilight“ erzählt im Wesentlichen die Liebesgeschichte zwischen der 17jährigen Schülerin Bella Swan und dem zumindest äußerlich gleichaltrigen Vampir Edward Cullen. Bella ist nach der Scheidung ihrer Eltern aus dem sonnigen Phoenix zu ihrem Vater in das verregnete Forks in der Nähe von Seattle gezogen, um ihren High-School-Abschluss zu machen. Dort ist sie erstmal „die Neue“, aber rasch weckt eine mysteriöse Familie ihre Aufmerksamkeit, die am Rande des kleinen Städtchens lebt. Insbesondere einer der „Söhne“, Edward Cullen, fasziniert sie auf ganz seltsame Weise und bereits nach kurzer Zeit verbindet die beiden eine besondere Beziehung. Es entwickelt sich eine ungewöhnliche Liebesbeziehung zwischen einer schüchternen und tollpatschigen Schülerin mit angeschlagenem Selbstbewusstsein sowie einem attraktiven und mysteriösen, jungen und unsterblichen Vampir, die fortan Stoff für vier Romane liefert. Gemeinsam müssen sich die beiden durch zahlreiche dramatische Situationen kämpfen, die nicht nur ihre ungewöhnliche Beziehung oftmals stark strapaziert, sondern auch ihre Freunde und Familien diverse Male in Lebensgefahr bringt.
Der erste Band, „Twilight„, ist in meinen Augen auch der beste der Reihe. Hier ist Meyers Schreibstil noch am sorgfältigsten, sie spendiert großzügig Adjektive und Adverbien und die Handlung ist abwechslungsreich und durchaus spannend aus der Sicht von Bella erzählt. Dieser erste Teil steht in meinen Augen auch am ehesten noch separat, während die folgenden Romane „Full Moon“, „Eclipse“ und „Breaking Dawn“ im Grunde schon fast eine Einheit bilden. „Full Moon“ ist eine kleine offensichtliche Hommage an „Romeo & Juliet“ während „Eclipse“ wiederum den Klassiker „Wuthering Heights“ als Vorbild nimmt. So manches Mal driftet die Erzählung in ausschweifende und romantisch verklärte Träumereien ab, aber ich denke das dürfte angesichts der jungen und weiblichen Zielgruppe keine große Überraschung darstellen. Die „Twilight“-Saga und die Hauptfigur Bella ist auch ein klassisches Beispiel für eine in Literatur gegossene „Wunschtraumerfüllung“ in Form eines idealen, märchenhaften Hauptcharakters, der magische Abenteuer meistern muss und der dadurch auch reichlich Identifikationsmöglichkeiten für die Leser (und die Autorin?) bietet.
Der Abschluss „Breaking Dawn“ ist dann allerdings in mehrfacher Hinsicht ein seltsames Produkt. Eigentlich ist die „Twilight“-Serie durch und durch eine romantische Teenager-Erzählung, die sich zunächst konservativen Moralvorstellungen verschrieben hat. Die komplizierte Beziehung zwischen einem Vampir und einer 17jährigen Schülerin schlägt erwartungsgemäß zunächst genau die richtigen Anspielungen auf die schwierige Annäherung an das andere Geschlecht in den Teenager-Jahren an. Doch im Finale „Breaking Dawn“ fällt Meyer dann plötzlich kannibalisch über ihre eigenen Prinzipien her und wählt einen bizarren Horror-Pfad, nur um dann am Ende doch wieder nur einen einfachen Ausweg zu suchen (was wohl auch wieder in die These der „Wunschtraumerfüllung“ passt). „Breaking Dawn“ wirkt überstürzt geschrieben, insbesondere im letzten Drittel scheinen ihr die Auswege (oder der Mut) für die im Laufe der Roman-Reihe eingeschlagenen Pfade ausgegangen zu sein. Obwohl meine Erwartungen im Vorfeld auch nicht sonderlich hoch waren, stellte das Ende dennoch eine gewisse Enttäuschung dar.
Der Hauptgrund, warum ich mich durch alle vier Bände „durchgearbeitet“ habe, war wohl ein gewisser sportlicher Ehrgeiz und auch Neugier. Ich wollte herausfinden, wie Meyer all diese Storyfäden zu einem Ende bringt — wie sie es schafft, die zentralen Probleme und Wünsche ihrer Charaktere zu befriedigen (oder nicht) und inwieweit sie dabei unbequeme Pfade wählen würde. Unbequem (oder unbefriedigend) war’s dann aber letztlich nur für den Leser, nicht für die Charaktere. Aber die Reihe als „schlecht“ zu bezeichnen wäre aus meiner Sicht auch unfair, denn Meyers Produkt ist angenehm leichte Kost — wenn man mit den entsprechenden Erwartungen an die Sache herangeht.
Auf der Hand liegt der Vergleich zu „Buffy„. Meyer hat nach eigenen Angaben noch nicht mehr als eine Folge von „Buffy“ gesehen. Die TV-Serie ging jedoch deutlich mutiger viel kontroversere Themen an und brachte die Vampir-Story als Metapher auf den alltäglichen Teenage-Horror viel weiter voran als Meyer es geschafft hat. Ihr gelingen nur wenige Andeutungen im Laufe der Reihe und am Ende verliert sie sich in ein überstürztes Finale, in dem sie schwierige Entscheidungen konsequent vermied. In diesem Aspekten enttäuscht dann die „Twilight“-Saga auch am meisten: Trotz des großen Potentials und des angenehmen Schreibstils von Meyer bleibt das Gesamtprodukt dann vor allem wegen dieser Oberflächlichkeit hinter den Möglichkeiten zurück.
Meyer gilt (zumindest in den großen Augen ihres Verlages) schon als neue J.K. Rowling, und mit dem fulminanten Einspielergebnis des „Twilight“-Films in den USA sowie der anlaufenden Merchandising-Lawine ist sie wohl zumindest finanziell auf dem Weg in diese Richtung. Offiziell gilt die „Twilight“-Saga mit dem Erscheinen des vierten Bands „Breaking Dawn“ als abgeschlossen. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man vor allem beim Verlag ein Interesse daran hat, das Franchise so schnell abzuhaken. Und dementsprechend sind auch schon weitere Projekte in der Pipeline: Ein „Official Twilight-Guide“ erschien vor wenigen Tagen, die Film-Fortsetzung der Teile zwei und drei werden gleich an einem Stück produziert und Meyer hat bereits angekündigt, dass ihr neuer Roman „Midnight Sun“ die Ereignisse des ersten Bands „Twilight“ aus der Sicht von Edward erzählen wird. Zudem hat sie bereits angedeutet, dass sie zwar die Geschichte von Bella & Edward als beendet ansieht, aber keineswegs die Geschichte der Vampir-Familie Cullen. Passenderweise lässt „Breaking Dawn“ auch genau dort noch viele Ansatzpunkte für weitere Erzählungen. Stephenie Meyer hat neben der Twilight-Reihe mittlerweile auch noch einen SciFi/Horror-Roman für Erwachsene veröffentlicht: „The Host“ nennt sich das Werk.
Die Verfilmung des ersten Teils, „Twilight„, kommt am 15. Januar auch in die deutschen Kinos. In der Hauptrolle ist Kristen Stewart zu sehen, die sich spätestens mit diesem Film einen Platz in der Top-Riege von Hollywoods Nachwuchsstars erobert hat. Kristen könnte vielleicht noch dem ein oder anderen aus dem exzellenten „Speak“ in Erinnerung sein, sie hatte mich jedenfalls schon damals beeindruckt.
Aus reinem „Forscherinteresse“ war auch das Twilight-Drehbuch (PDF via raindance.co.uk) aufschlussreich — schließlich stellt sich hier wieder das alte Problem: Wie transformiert man die 500 Seiten einer Romanvorlage in einen 90-Minuten-Spielfilm? Dementsprechend liest sich das Drehbuch wie eine Cliffnotes-Version der Vorlage und zumindest aus diesem Blickwinkel ist es einigermaßen interessant zu sehen, wo Autorin Melissa Rosenberg Abkürzungen wählt und wie sie nahezu ohne Voice Over auskommt.
Geez, jetzt habe ich doch tatsächlich mehr als tausend Wörter über eine Romanreihe geschrieben, die mich eigentlich gar nicht sonderlich begeistern konnte. Herrlich.
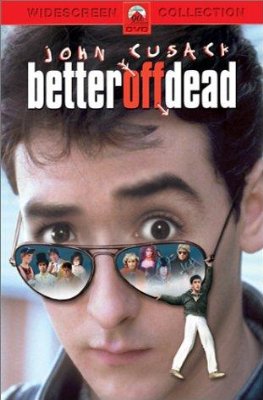 Der Teenager Lane Meyer (Cusack) hat gerade erfahren, dass seine große Liebe Beth mit ihm Schluss gemacht hat, weil er nicht populär genug ist. Der arme Lane versucht sich zunächst auf bizarre Art und Weise das Leben zu nehmen, doch dann besinnt er sich eines besseren Plans und will Beth zurückzugewinnen, in dem er den Kapitän des Schul-Ski-Teams(!) auf der Piste besiegt. Dabei verliebt er sich in die hübsche Austauschstudentin Monique, wird von einem unermüdlichen Zeitungsjunge verfolgt, muss den unangenehmen Nachbarsjungen Ricky ertragen und das alltägliche Leben mit seinen surrealen Eltern meistern.
Der Teenager Lane Meyer (Cusack) hat gerade erfahren, dass seine große Liebe Beth mit ihm Schluss gemacht hat, weil er nicht populär genug ist. Der arme Lane versucht sich zunächst auf bizarre Art und Weise das Leben zu nehmen, doch dann besinnt er sich eines besseren Plans und will Beth zurückzugewinnen, in dem er den Kapitän des Schul-Ski-Teams(!) auf der Piste besiegt. Dabei verliebt er sich in die hübsche Austauschstudentin Monique, wird von einem unermüdlichen Zeitungsjunge verfolgt, muss den unangenehmen Nachbarsjungen Ricky ertragen und das alltägliche Leben mit seinen surrealen Eltern meistern. Im Mittelpunkt von „Heathers“ stehen titelgebend drei Freundinnen (u.a. Shannen Doherty), die allesamt Heather heißen und in der Popularitäts-Hierachie an der Westerberg Highschool ganz oben stehen. Sie geben an, wer In und Out ist. Wer sich nicht dem berüchtigten Willen der Heathers fügt, kann sich als geächtet betrachten. Nicht damit zurecht kommt Veronica (Winona Ryder), die eigentlich kurz davor steht, ebenfalls in den erlauchten Kreis der „Heathers“ aufgenommen zu werden. Doch sie distanziert sich von den Unterdrücker-Methoden der Clique und macht sich somit drei neue Feindinnen. Nebenbei verliebt sie sich in den jungen Rebellen J.D. ( Christian Slater), der neu an der High-School ist. Ihm klagt sie ihr Leid mit den Heathers und wieviel besser die Welt doch ohne diese Zicken wäre. In einer Verkettung sehr bizarrer Umstände ermorden J.D. und Veronica eine der Heathers — nicht ganz unabsichtlich. Sie tarnen den Mord als Selbstmord und setzen damit eine noch unheilvollere Kette von Ereignissen in Bewegung. Rasch wird das Verhalten von J.D. unkontrollierbar, gleichzeitig wird die Schule von bizarren Anti-Selbstmord-Kampagnen überflutet.
Im Mittelpunkt von „Heathers“ stehen titelgebend drei Freundinnen (u.a. Shannen Doherty), die allesamt Heather heißen und in der Popularitäts-Hierachie an der Westerberg Highschool ganz oben stehen. Sie geben an, wer In und Out ist. Wer sich nicht dem berüchtigten Willen der Heathers fügt, kann sich als geächtet betrachten. Nicht damit zurecht kommt Veronica (Winona Ryder), die eigentlich kurz davor steht, ebenfalls in den erlauchten Kreis der „Heathers“ aufgenommen zu werden. Doch sie distanziert sich von den Unterdrücker-Methoden der Clique und macht sich somit drei neue Feindinnen. Nebenbei verliebt sie sich in den jungen Rebellen J.D. ( Christian Slater), der neu an der High-School ist. Ihm klagt sie ihr Leid mit den Heathers und wieviel besser die Welt doch ohne diese Zicken wäre. In einer Verkettung sehr bizarrer Umstände ermorden J.D. und Veronica eine der Heathers — nicht ganz unabsichtlich. Sie tarnen den Mord als Selbstmord und setzen damit eine noch unheilvollere Kette von Ereignissen in Bewegung. Rasch wird das Verhalten von J.D. unkontrollierbar, gleichzeitig wird die Schule von bizarren Anti-Selbstmord-Kampagnen überflutet. Auch jenseits von diesen „gesellschaftskritischen“ Punkten ist „Heathers“ ein großer Filmgenuss für Freunde der 80er-Kultur. Besonders fällt eine erschreckend junge Winona Ryder ins Auge (gerade mal 17 Lenze, kurz nach ihrem Durchbruch mit „Beetlejuice“, und noch Jahre entfernt von ihrem „Generation X“-Kultstatus mit „Reality Bites“). Schon damals beeindruckt ihre unverkrampfte und muntere Schauspielerei. Ich musste nun erstmal wieder
Auch jenseits von diesen „gesellschaftskritischen“ Punkten ist „Heathers“ ein großer Filmgenuss für Freunde der 80er-Kultur. Besonders fällt eine erschreckend junge Winona Ryder ins Auge (gerade mal 17 Lenze, kurz nach ihrem Durchbruch mit „Beetlejuice“, und noch Jahre entfernt von ihrem „Generation X“-Kultstatus mit „Reality Bites“). Schon damals beeindruckt ihre unverkrampfte und muntere Schauspielerei. Ich musste nun erstmal wieder 
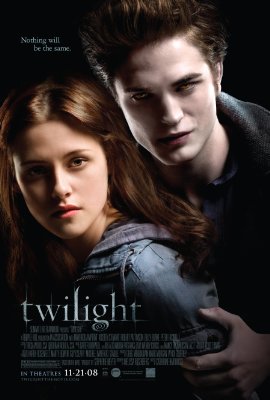 Die „Twilight“-Saga fällt eigentlich in den Bereich der „Young Adult“-Literatur und richtet sich auch wohl vor allem an die weibliche Leserschaft — also schon gleich zwei wesentliche Zielgruppen-Kriterien, die ich nicht erfülle — was mir aber wie eingangs erwähnt recht egal war. „Twilight“ erzählt im Wesentlichen die Liebesgeschichte zwischen der 17jährigen Schülerin Bella Swan und dem zumindest äußerlich gleichaltrigen Vampir Edward Cullen. Bella ist nach der Scheidung ihrer Eltern aus dem sonnigen Phoenix zu ihrem Vater in das verregnete Forks in der Nähe von Seattle gezogen, um ihren High-School-Abschluss zu machen. Dort ist sie erstmal „die Neue“, aber rasch weckt eine mysteriöse Familie ihre Aufmerksamkeit, die am Rande des kleinen Städtchens lebt. Insbesondere einer der „Söhne“, Edward Cullen, fasziniert sie auf ganz seltsame Weise und bereits nach kurzer Zeit verbindet die beiden eine besondere Beziehung. Es entwickelt sich eine ungewöhnliche Liebesbeziehung zwischen einer schüchternen und tollpatschigen Schülerin mit angeschlagenem Selbstbewusstsein sowie einem attraktiven und mysteriösen, jungen und unsterblichen Vampir, die fortan Stoff für vier Romane liefert. Gemeinsam müssen sich die beiden durch zahlreiche dramatische Situationen kämpfen, die nicht nur ihre ungewöhnliche Beziehung oftmals stark strapaziert, sondern auch ihre Freunde und Familien diverse Male in Lebensgefahr bringt.
Die „Twilight“-Saga fällt eigentlich in den Bereich der „Young Adult“-Literatur und richtet sich auch wohl vor allem an die weibliche Leserschaft — also schon gleich zwei wesentliche Zielgruppen-Kriterien, die ich nicht erfülle — was mir aber wie eingangs erwähnt recht egal war. „Twilight“ erzählt im Wesentlichen die Liebesgeschichte zwischen der 17jährigen Schülerin Bella Swan und dem zumindest äußerlich gleichaltrigen Vampir Edward Cullen. Bella ist nach der Scheidung ihrer Eltern aus dem sonnigen Phoenix zu ihrem Vater in das verregnete Forks in der Nähe von Seattle gezogen, um ihren High-School-Abschluss zu machen. Dort ist sie erstmal „die Neue“, aber rasch weckt eine mysteriöse Familie ihre Aufmerksamkeit, die am Rande des kleinen Städtchens lebt. Insbesondere einer der „Söhne“, Edward Cullen, fasziniert sie auf ganz seltsame Weise und bereits nach kurzer Zeit verbindet die beiden eine besondere Beziehung. Es entwickelt sich eine ungewöhnliche Liebesbeziehung zwischen einer schüchternen und tollpatschigen Schülerin mit angeschlagenem Selbstbewusstsein sowie einem attraktiven und mysteriösen, jungen und unsterblichen Vampir, die fortan Stoff für vier Romane liefert. Gemeinsam müssen sich die beiden durch zahlreiche dramatische Situationen kämpfen, die nicht nur ihre ungewöhnliche Beziehung oftmals stark strapaziert, sondern auch ihre Freunde und Familien diverse Male in Lebensgefahr bringt. Der schüchterne und einsame 12jährige Oskar wird in der Schule gehänselt und ist der klassische Aussenseiter-Typ ohne echte Freunde. Die Ehe seiner Eltern ist gescheitert, er lebt alleine mit seiner Mutter in einem ruhigen Vorort von Stockholm. Eines Tages im tiefen Winter wird in der Nachbarschaft die Leiche eines ermordeten Jungen gefunden, dem ein Großteil seines Blutes entnommen wurde. Interessiert verfolgt Oskar die Berichterstattung über diesen und folgende Morde in der Presse. Kurz darauf lernt er das etwa gleichaltrige Mädchen Eli kennen, das in einer Nachbarwohnung eingezogen ist. Oskar benötigt nicht lange, um festzustellen, dass dieses „Mädchen“ alles andere als ein normaler Teenager ist. Sie ist eine blutdurstige Vampir(in), die seit vielen Jahrzehnten durch Schweden zieht — auf alle Zeit in ihrem Teenager-Körper gefangen. Rasch sieht Oskar in Eli eine Verbündete in seinem einsamen Leben, „sie“ gibt ihm den Mut, sich gegen die Hänseleien in der Schule zu wehren — mit zweischneidigem Erfolg. Obwohl er sich bewusst ist, dass seine ungewöhnliche Bekanntschaft auf das Blut anderer Menschen zum Überleben angewiesen ist, sucht er ihre Nähe und bringt damit schließlich auch Eli in einen schwierigen Interessenkonflikt.
Der schüchterne und einsame 12jährige Oskar wird in der Schule gehänselt und ist der klassische Aussenseiter-Typ ohne echte Freunde. Die Ehe seiner Eltern ist gescheitert, er lebt alleine mit seiner Mutter in einem ruhigen Vorort von Stockholm. Eines Tages im tiefen Winter wird in der Nachbarschaft die Leiche eines ermordeten Jungen gefunden, dem ein Großteil seines Blutes entnommen wurde. Interessiert verfolgt Oskar die Berichterstattung über diesen und folgende Morde in der Presse. Kurz darauf lernt er das etwa gleichaltrige Mädchen Eli kennen, das in einer Nachbarwohnung eingezogen ist. Oskar benötigt nicht lange, um festzustellen, dass dieses „Mädchen“ alles andere als ein normaler Teenager ist. Sie ist eine blutdurstige Vampir(in), die seit vielen Jahrzehnten durch Schweden zieht — auf alle Zeit in ihrem Teenager-Körper gefangen. Rasch sieht Oskar in Eli eine Verbündete in seinem einsamen Leben, „sie“ gibt ihm den Mut, sich gegen die Hänseleien in der Schule zu wehren — mit zweischneidigem Erfolg. Obwohl er sich bewusst ist, dass seine ungewöhnliche Bekanntschaft auf das Blut anderer Menschen zum Überleben angewiesen ist, sucht er ihre Nähe und bringt damit schließlich auch Eli in einen schwierigen Interessenkonflikt.
 „Once“ erzählt die kurze Geschichte einer intensiven Freundschaft zwischen einem „guy“ und einem „girl“ (selbst im Abspann gibt’s keine Namen), die sich in einer Fußgängerzone kennenlernen. Er (Glen Hansard) ist Straßenmusiker und eigentlich auch noch Staubsauger-Mechaniker, sie (Marketa Irglova) kommt aus Tschechien und hält sich mit Gegenheitsjobs wie dem Verkauf von Rosen über Wasser. Aber sie ist auch eine begeisterte und begabte Klavierspielerin und über die Musik kommen sich die beiden innerhalb kürzester Zeit sehr nahe. Das Paar ist sich auf Anhieb sympathisch und gemeinsam beginnen sie, seine Eigenkompositionen zu spielen und wagen sich schließlich sogar an die kostspielige Aufnahme einer Demo-CD. Doch was sich vielleicht nach einer simplen romantischen Love-Story im Stil von „
„Once“ erzählt die kurze Geschichte einer intensiven Freundschaft zwischen einem „guy“ und einem „girl“ (selbst im Abspann gibt’s keine Namen), die sich in einer Fußgängerzone kennenlernen. Er (Glen Hansard) ist Straßenmusiker und eigentlich auch noch Staubsauger-Mechaniker, sie (Marketa Irglova) kommt aus Tschechien und hält sich mit Gegenheitsjobs wie dem Verkauf von Rosen über Wasser. Aber sie ist auch eine begeisterte und begabte Klavierspielerin und über die Musik kommen sich die beiden innerhalb kürzester Zeit sehr nahe. Das Paar ist sich auf Anhieb sympathisch und gemeinsam beginnen sie, seine Eigenkompositionen zu spielen und wagen sich schließlich sogar an die kostspielige Aufnahme einer Demo-CD. Doch was sich vielleicht nach einer simplen romantischen Love-Story im Stil von „ Der Film erzählt die Coming-of-Age-Geschichte der 17-jährigen Schülerin Makoto, die eines Tages bemerkt, dass sie Zeitsprünge machen kann. Zuerst nutzt sie ihre neue Fähigkeit für allerlei Dummheiten und Kleinigkeiten, doch wie es in Zeitreisen-Filmen nun mal so üblich ist, drohen bald üble Konsequenzen ihrer Taten und mit jeden Zeitsprung scheint ihre Umwelt und ihr Leben immer mehr aus den Fugen zu geraten. Zudem entdeckt sie ihre Zuneigung für einen ihrer Schulfreunde und kommt mit diesen Empfindungen zunächst gar nicht zurecht.
Der Film erzählt die Coming-of-Age-Geschichte der 17-jährigen Schülerin Makoto, die eines Tages bemerkt, dass sie Zeitsprünge machen kann. Zuerst nutzt sie ihre neue Fähigkeit für allerlei Dummheiten und Kleinigkeiten, doch wie es in Zeitreisen-Filmen nun mal so üblich ist, drohen bald üble Konsequenzen ihrer Taten und mit jeden Zeitsprung scheint ihre Umwelt und ihr Leben immer mehr aus den Fugen zu geraten. Zudem entdeckt sie ihre Zuneigung für einen ihrer Schulfreunde und kommt mit diesen Empfindungen zunächst gar nicht zurecht. „The King of California“ erzählt eine kleine Vater-Tocher-Geschichte: Die 16jährige Miranda (Evan Rachel Wood) muss seit Jahren alleine zurecht kommen nachdem ihre Mutter die Familie verlassen hatte und ihr Vater in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Irgendwie hat Miranda es geschafft, sich an den Jugendämtern vorbeizumogeln, hat die Schule geschmissen und arbeitet in einer McDonalds-Filiale, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie hat ihr einsames Leben soweit im Griff, doch eines Tages steht ihr Vater Charlie (Michael Douglas mit „Catweazel“-Look) wieder vor der Tür: Entlassen aus der Anstalt, aber nicht unbedingt vollständig geheilt, versucht er sich wieder in das Leben seiner Tochter zu integrieren. Miranda ist davon alles andere als begeistert. Schon bald fällt Charlie scheinbar wieder in alte, anormale Verhaltensmuster zurück: Besessen von der Idee, dass in der Nähe ein 300 Jahre alter Goldschatz vergraben sei, macht sich Charlie mit Metalldetektor und schwerem Gerät auf Schatzsuche. Seiner Tochter Miranda bleibt trotz anfänglichen Widerstands nichts anderes übrig, als Babysitter für ihren Vater zu spielen. Während sich die beiden allmählich wieder besser kennen lernen und gar Gemeinsamkeiten entdecken, wird auch Miranda in den Bann der Schatzsuche gezogen, die schließlich ausgerechnet in/unter einem Supermarkt ihren Höhepunkt findet.
„The King of California“ erzählt eine kleine Vater-Tocher-Geschichte: Die 16jährige Miranda (Evan Rachel Wood) muss seit Jahren alleine zurecht kommen nachdem ihre Mutter die Familie verlassen hatte und ihr Vater in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Irgendwie hat Miranda es geschafft, sich an den Jugendämtern vorbeizumogeln, hat die Schule geschmissen und arbeitet in einer McDonalds-Filiale, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie hat ihr einsames Leben soweit im Griff, doch eines Tages steht ihr Vater Charlie (Michael Douglas mit „Catweazel“-Look) wieder vor der Tür: Entlassen aus der Anstalt, aber nicht unbedingt vollständig geheilt, versucht er sich wieder in das Leben seiner Tochter zu integrieren. Miranda ist davon alles andere als begeistert. Schon bald fällt Charlie scheinbar wieder in alte, anormale Verhaltensmuster zurück: Besessen von der Idee, dass in der Nähe ein 300 Jahre alter Goldschatz vergraben sei, macht sich Charlie mit Metalldetektor und schwerem Gerät auf Schatzsuche. Seiner Tochter Miranda bleibt trotz anfänglichen Widerstands nichts anderes übrig, als Babysitter für ihren Vater zu spielen. Während sich die beiden allmählich wieder besser kennen lernen und gar Gemeinsamkeiten entdecken, wird auch Miranda in den Bann der Schatzsuche gezogen, die schließlich ausgerechnet in/unter einem Supermarkt ihren Höhepunkt findet. Zu den anderen „Macken“ gehört vielleicht auch der etwas zu umfangreich eingesetzte Voice-Over im Film, der vor allem aus der Sicht von Miranda erzählt wird. Bei manchen Kritikern wurde gar polemisch spekuliert, dass nur deshalb Voice-Over verwendet wurden, um das Geld für einen weiteren Darsteller einzusparen. Ganz so kritisch sehe ich das allerdings nicht — der Fokus des Films soll auf der schwierigen Beziehung zwischen Vater und Tochter liegen, ein weiterer Charakter, dem Miranda dann brav all ihre Gefühle und Gedanken erzählt, hätte nur unnötig von diesem Schwerpunkt abgelenkt. Zwar mag nicht jeder Voice-Over so brillant eingesetzt sein wie der in „Juno“ (im Sinne einer Kommunikation mit dem Zuschauer), aber ich bin ohnehin ein Freund von (moderat eingesetzten) Voice-Overs, insofern fand ich den Einsatz dieser Technik in „King of California“ nicht sonderlich störend.
Zu den anderen „Macken“ gehört vielleicht auch der etwas zu umfangreich eingesetzte Voice-Over im Film, der vor allem aus der Sicht von Miranda erzählt wird. Bei manchen Kritikern wurde gar polemisch spekuliert, dass nur deshalb Voice-Over verwendet wurden, um das Geld für einen weiteren Darsteller einzusparen. Ganz so kritisch sehe ich das allerdings nicht — der Fokus des Films soll auf der schwierigen Beziehung zwischen Vater und Tochter liegen, ein weiterer Charakter, dem Miranda dann brav all ihre Gefühle und Gedanken erzählt, hätte nur unnötig von diesem Schwerpunkt abgelenkt. Zwar mag nicht jeder Voice-Over so brillant eingesetzt sein wie der in „Juno“ (im Sinne einer Kommunikation mit dem Zuschauer), aber ich bin ohnehin ein Freund von (moderat eingesetzten) Voice-Overs, insofern fand ich den Einsatz dieser Technik in „King of California“ nicht sonderlich störend.