Was für eine Baustelle. Für die „October Road“ wäre eigentlich eine Vollsperrung samt neuer Fahrbahndecke dringend nötig — dabei wurde die Strecke erst für den Verkehr … nah, ich lass‘ das jetzt lieber mit den Analogien.
Aber es kommt ja wirklich selten vor, dass eine Pilot-Episode derart übel ist, dass sie von der zweiten Folge schon locker übertrumpft wird. Folge eins von „October Road“ ist ein unfertiges Melange von melodramatischen Selbstfindungs-Szenen, einem um mehre Größenordnungen überdimensionierten Soundtrack, katastrophal gezeichneten Charakteren, blassen Darstellern, ausgelutschten Story-Konzepten … und einigen wenigen guten Ideen. Hat sich das denn niemand der Powers That Be mal vor der Ausstrahlung angesehen?
 Der verlorene Sohn Nick Garrett (Bryan Greenberg, könnte dem Gehabe nach fast der Bruder von Milo Ventimiglia sein) kommt also nach zehn Jahren zurück in sein Heimatdorf. Und natürlich steckt er in einer Sinnkrise, hat all seine Freunde vor drei Jahren zudem durch eine biographisch angehauchte Buchveröffentlichung vergrault. Die sind nun entweder stinksauer oder derart überzeichnete Charaktere, dass sie eh keine rational fundierte Entscheidung treffen dürfen, damit die Story wenigstens den Hauch einer Existenzberechtigung hat. Und pünktlich zum zweiten Act-Break (taraa!) wird uns dann auch der eigentliche Höhepunkt präsentiert: Der zehnjährige Sohn von Nicks Ex. Während der Werbepause darf dann gerechnet werden.
Der verlorene Sohn Nick Garrett (Bryan Greenberg, könnte dem Gehabe nach fast der Bruder von Milo Ventimiglia sein) kommt also nach zehn Jahren zurück in sein Heimatdorf. Und natürlich steckt er in einer Sinnkrise, hat all seine Freunde vor drei Jahren zudem durch eine biographisch angehauchte Buchveröffentlichung vergrault. Die sind nun entweder stinksauer oder derart überzeichnete Charaktere, dass sie eh keine rational fundierte Entscheidung treffen dürfen, damit die Story wenigstens den Hauch einer Existenzberechtigung hat. Und pünktlich zum zweiten Act-Break (taraa!) wird uns dann auch der eigentliche Höhepunkt präsentiert: Der zehnjährige Sohn von Nicks Ex. Während der Werbepause darf dann gerechnet werden.
Viele Momente laden schon beinahe zu unfreiwilliger Komik ein, seien es die stümperhaften Opening Credits (Nicks Auto schliddert in eine vom CGI-Praktikanten mit Paintshop gemalte Ortseinfahrt). Oder wenn die absolut nüchteren twentysomething-Protagonisten nicht nur zur Luftgitarre greifen, sondern gleich mehrminütige Luft-Band-Nummern daraus bauen, die an Lächerlichkeit kaum zu übertreffen sind. Man greift sich auch schon mal an den Kopf, wenn irgendwelche dürftigen und absurden Lebensphilosophien von Vorfahren als wesentliche Plot-Begründungen dem Zuschauer gleich mehrmals vor die Füße geworfen werden. Oder der Hauptcharakter Nick seine Sinnkrise nur zehn Minuten nach einem (vorhersehbaren) Beinahe-Nervenzusammenbruch wunderbar eloquent einer wildfremden Studentin als perfekte Selbst-Diagnose offenbart. Nur um ganz sicher zu gehen, dass der Zuschauer auch wirklich nachvollziehen kann, was in Nick vorgeht, falls er die vorangegangenen Zaunpfähle übersehen haben sollte. Selbst „Dawson’s Creek“ war da subtiler. Oder jemand sein größtes Sexgeheimnis ausgerechnet dem Freund anvertraut, der vor einigen Jahren den Unmut eines ganzen Dorfviertels auf sich zog, weil er ein Buch über sie veröffentlichte…
Aber die Show hat durchaus auch ein paar gute Aspekte. Man kann erkennen, dass die Serie aufbauend auf einige zentrale emotionale Schlüsselszenen konstruiert wurde, die prinzipiell vielleicht sogar die Grundlage für eine interessante Show bilden könnten. Dazu zählen beispielsweise viele der „First Contact“-Momente zwischen Nick und seiner alten Heimat. Auch die Grund-Idee mit Nicks möglichen Kind ist gar nicht so verkehrt. So war das Leuchten in den Augen (und die nachfolgenden Aktionen) des vermeintlichen Großvaters einfach nur bezaubernd ausgedacht und umgesetzt. Doch das schon nach nur 80 Minuten schier endlos erscheinende Hin-und-Her von Anspielungen hinsichtlich der wahren Abstammung des Kindes wirkt einfach nur noch affig.
Der Soundtrack wiederum wäre wirklich exzellent (lauter gute Songs), wäre er nicht so aufdringlich und teilweise gnadenlos antiklimaktisch und orthogonal zum Geschehen auf dem Bildschirm eingebunden. Auch das Casting von Laura Prepon („That 70s Show“) war eine durchaus gut gewählte Entscheidung, endlich kann sie auch mal zeigen, ob sie jenseits der eher simpel gestrickten Comedy auch mehr ernstere (und ältere) Charaktere geben kann. Und prompt ist sie auch neben Tom Berenger (als Großvater in spe) eine der wenigen schauspielerischen Highlights der insgesamt doch eher lauen Serie.
Die zweite Episode geht die Sache etwas langsamer an und muss auch nicht mehr soviel Exposition bewältigen, so dass die Charaktere größere Gelegenheiten zum Entfalten haben. Aber auch hier sind zahlreiche Dialoge eingestreut, die im Kopf der Autoren wohl ganz großes emotionales Kino repräsentierten, aber auf dem Bildschirm einfach nur blass und überdimensioniert für diese einfachen Charaktere wirken.
Naha, wer sich eine Home-Coming-Story anschauen will sollte doch zu einer guten, alten DVD greifen und sich „Garden State“, „Winter Passing“ oder zur Not auch „Elizabethtown“ zu Gemüte führen. Einzig Fans der bezaubernden Laura Prepon müssen wohl auch weiterhin einen Parkplatz in der October Road suchen. Pünktlich zu den Upfronts könnte das aber in einer Sackgasse enden. (Okay, das bot sich jetzt einfach zu offensichtlich an 😉 Die Quoten sind recht gut, allerdings nur ca 50-60% Retention von Grey’s Anatomy. Und es kommen ja nur noch zwei Episoden).
 Ich war begeistert von dem mal etwas anderen Voice-Over-Konzept der Pilotepisode, in der ein vermeintlich unzuverlässiger Dritter die Geschichte aus dem Off erzählt. Die Problematik des „Woher-kann-der-das-denn-wissen“ war elegant gelöst, indem man gleich mehrmals den Finger drauflegte und sogar noch mit einem Running-Gag verbinden konnte („Where did you come from?“). Doch mittlerweile hat es den Anschein, als solle die Integrität des Erzählers nun doch nicht mehr so fragwürdig sein, wie zuvor angedeutet. Gerade die mögliche Unzuverlässigkeit des Erzählers (der in der Pilotepisode seine Geschichte gleich mehrmals fundamental änderte) war eines der Storytelling-Highlights und auch Alleinstellungsmerkmal, auf das die Macher nun zu verzichten scheinen. So erscheint auch dieses „Feature“ mittlerweile nur wie ein Voice Over wie jeder andere, nur in diesem Fall auch noch von einem weitesgehend unbeteiligten (und öden) Charakter. Die kurzen Vorgriffe und Anspielungen auf zukünftige Ereignisse wirkt zudem wie ein läppischer Versuch, den Zuschauer bei der Stange zu halten, weil der wohl schon die größeren Zusammenhänge mangels Interesse aus dem Auge verloren hat.
Ich war begeistert von dem mal etwas anderen Voice-Over-Konzept der Pilotepisode, in der ein vermeintlich unzuverlässiger Dritter die Geschichte aus dem Off erzählt. Die Problematik des „Woher-kann-der-das-denn-wissen“ war elegant gelöst, indem man gleich mehrmals den Finger drauflegte und sogar noch mit einem Running-Gag verbinden konnte („Where did you come from?“). Doch mittlerweile hat es den Anschein, als solle die Integrität des Erzählers nun doch nicht mehr so fragwürdig sein, wie zuvor angedeutet. Gerade die mögliche Unzuverlässigkeit des Erzählers (der in der Pilotepisode seine Geschichte gleich mehrmals fundamental änderte) war eines der Storytelling-Highlights und auch Alleinstellungsmerkmal, auf das die Macher nun zu verzichten scheinen. So erscheint auch dieses „Feature“ mittlerweile nur wie ein Voice Over wie jeder andere, nur in diesem Fall auch noch von einem weitesgehend unbeteiligten (und öden) Charakter. Die kurzen Vorgriffe und Anspielungen auf zukünftige Ereignisse wirkt zudem wie ein läppischer Versuch, den Zuschauer bei der Stange zu halten, weil der wohl schon die größeren Zusammenhänge mangels Interesse aus dem Auge verloren hat.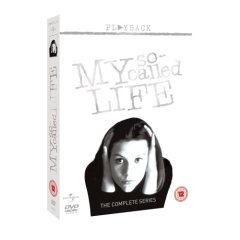 Bis vor ein paar Wochen. Denn da tauchte auf amazon.co.uk erstmals das Listing einer
Bis vor ein paar Wochen. Denn da tauchte auf amazon.co.uk erstmals das Listing einer 
 Der verlorene Sohn Nick Garrett (Bryan Greenberg, könnte dem Gehabe nach fast der Bruder von Milo Ventimiglia sein) kommt also nach zehn Jahren zurück in sein Heimatdorf. Und natürlich steckt er in einer Sinnkrise, hat all seine Freunde vor drei Jahren zudem durch eine biographisch angehauchte Buchveröffentlichung vergrault. Die sind nun entweder stinksauer oder derart überzeichnete Charaktere, dass sie eh keine rational fundierte Entscheidung treffen dürfen, damit die Story wenigstens den Hauch einer Existenzberechtigung hat. Und pünktlich zum zweiten Act-Break (taraa!) wird uns dann auch der eigentliche Höhepunkt präsentiert: Der zehnjährige Sohn von Nicks Ex. Während der Werbepause darf dann gerechnet werden.
Der verlorene Sohn Nick Garrett (Bryan Greenberg, könnte dem Gehabe nach fast der Bruder von Milo Ventimiglia sein) kommt also nach zehn Jahren zurück in sein Heimatdorf. Und natürlich steckt er in einer Sinnkrise, hat all seine Freunde vor drei Jahren zudem durch eine biographisch angehauchte Buchveröffentlichung vergrault. Die sind nun entweder stinksauer oder derart überzeichnete Charaktere, dass sie eh keine rational fundierte Entscheidung treffen dürfen, damit die Story wenigstens den Hauch einer Existenzberechtigung hat. Und pünktlich zum zweiten Act-Break (taraa!) wird uns dann auch der eigentliche Höhepunkt präsentiert: Der zehnjährige Sohn von Nicks Ex. Während der Werbepause darf dann gerechnet werden.